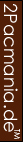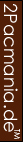In Ewigkeit, yo man
Vor zehn Jahren drehte seine Cousine einen Joint aus seiner Asche – Tupac Shakur ist also: tot. Tot? Der erste Weltstar des Hip-Hop erscheint ständig frisch auf Platte, die Geschichte seines Lebens und Sterbens wird immer wieder neu verkündet. Endgültig
Las Vegas vergisst schnell. Keine Gedenktafel, nichts erinnert an der schäbigen Strassenkreuzung an den 7. September 1996. Ein alter Cadillac schob sich damals am Rotlicht neben den schwarzen BMW 750 Sedan, hinter dessen getönten Scheiben der Rapper Tupac und sein Impresario Marion «Suge» Knight sassen. Vom Rücksitz des Cadillacs wurden Schüsse abgefeuert, «Drive-by-Shooting» heisst das im Rap-Jargon. Der Schütze zielt genau: Den hageren Tupac trifft er dreimal, der korpulente Knight wird nur von Hülsen- und Glassplittern gestreift. Dann taucht der weisse Cadillac ins Dunkel weg, der Täter wird nie gefasst. Tupac erliegt sechs Tage später den Verletzungen. «Wir nehmen nicht zu ungelösten Fällen Stellung, auf Wiederhören», bescheidet die Mordkommission der Las Vegas Metropolitan Police noch zehn Jahre später.
Jetzt ist Tupac Amaru Shakur eine Wachsfigur. Für Augenblicke wähnt man ihn leibhaftig dort hinten im Halbdunkel. Lauernd steht er da, mit nacktem Oberkörper, den Kopf leicht gesenkt, auf der Brust ein goldenes Kreuz, die Hände vor dem Bauch gefaltet wie zum Gebet, jede Narbe, jede Tätowierung an ihrem Platz, «2Pac» ist über die linke Brust geritzt, ein Totenkopf in den rechten Oberarm. Die vollen Lippen, das Millimeterschnurrbärtchen, die seitlich abfallenden braunen Mandelaugen, die dichten Brauen, alles wirkt echt. Tupac blickt bittend, ein wissender Bub. Es ist, als beobachte er an diesem Morgen im April bei Madame Tussauds Las Vegas in einem Seitenflügel des Hotels «Venetian» die feierliche Enthüllung seiner selbst. Freunde und Verwandte sind gekommen, eine Fernsehstation überträgt live via Satellit.
«In Umfragen, wen die Besucher gern als Wachsfigur sähen, belegte er stets Rang eins», charmiert Tussauds-Direktor Adrian Jones druckreif ins Mikrofon. Andere Heroen der Black Music stehen schon hier, Jimi Hendrix, Stevie Wonder, Michael Jackson, Prince, auch R&B-Schätzchen Beyoncé. Doch nie zuvor wurde in einem der weltweit fünf Madame-Tussauds-Kabinette ein Rapper in Wachs verewigt, nicht Eminem, nicht Jay-Z, keiner. «Mein Gott, er sieht so lebendig aus!», kreischt Dina Taylor ein ums andere Mal. Die pummelige Hausfrau aus Denver, Colorado, hat die Kinder zur Schwiegermutter gebracht und ist eigens hergeflogen. Sie legt den Arm um ihr Idol, ihr Gatte knipst, «one more, one more!»
Tupacs Unterhose ragt, wie das Genre es verlangt, über den Bund der Jeans. «Zunächst wählte die Museumsleitung einen markenlosen Slip, aber Pac trug immer Armani-Shorts», sagt die Schwester des Rappers, Sekyiwa «Set» Shakur, Modedesignerin aus Atlanta, eine mächtige Schönheit mit sehr dunkler Haut und steckengeradem langem Haar. Stört es sie nicht, jetzt für alle Zeiten nur noch «Tupacs Schwester» zu sein? «Genau das bin ich doch. Nur dank ihm kann ich meine Kleiderlinie herausgeben.» Madam Veli, der Name ihres Modelabels, bezieht sich auf das Pseudonym des toten Bruders, Makaveli. Sekyiwa verrenkt aus Verlegenheit ihre langen Finger, dass es knackt. «Es ist schmeichelhaft, dass Pac nach zehn Jahren endlich diese Anerkennung bekommt», sagt sie. Dann weint auch sie ein bisschen, wie alle Umstehenden. Und aus den Lautsprechern, gespenstisch, rappt Tupac: «Jeder Tag könnte mein letzter sein, das kommt halt davon, wenn man das Leben schnell lebt.»
Nur Minuten nach der Einweihungszeremonie gibt es ihn drunten im Museumsshop schon auf Shirts und Tassen zu kaufen – neben US-Ikonen wie Marilyn Monroe, Elvis und John Wayne. Hat nun die Heiligsprechung eines Hurensohns eingesetzt? Wir wissen doch, was dieser Tupac für einer war. Der uneheliche Spross einer straffälligen Drogensüchtigen schiesst und prügelt sich durch ein kurzes Leben, grosse Schnauze, wenig Hirn. Er dealt, vergewaltigt, gerät hinter Gitter, kommt gegen Kaution frei, rappt mit Vorliebe über Knarren und Fotzen, avanciert zum erfolgreichsten Sprechsänger seiner Zeit, wird in einer erbärmlichen Gang-Abrechnung erschossen – die Story von Aufstieg und Fall des Gettobuben Tupac Shakur ist rasch erzählt. Nur stimmt sie nicht.
Kleiner, kleiner Kurt Cobain
«Auf jeder seiner Platten gibt es Botschaften, die von sozialem und politischem Bewusstsein zeugen, aber die Medien stürzen sich halt auf die kruden ‹Ich komm mit meiner Knarre zu dir nach Hause›-Songs.» Dina LaPolt, die blonde, grossgewachsene Anwältin, bemüht sich hörbar um einen ordinären kalifornischen Rockerinnen-Slang und stützt sich lässig auf den wächsernen Prince, den sie um drei Kopflängen überragt. LaPolt, Tupacs Mutter Afeni und die PR-Frau Versa Manos verwalten den Nachlass des untoten Rappers. Und setzen in Büchern, Filmdokumentationen und Platten den Hass-Raps zärtliche Liebesbriefe aus Tupacs Feder entgegen, den Aufschneiderparolen feinsinnige Poeme. «Wir drei Weiber haben uns in diesem Macho-Business Respekt verschafft», sagt LaPolt. Sie und Anwalt Donald David haben in jahrelangem Klein-Klein für die Familie die Rechte an Tupacs Werk zurückerstritten, darunter 153 unveröffentlichte Songs, die «Suge» Knight für sich beanspruchte. Knights Plattenfirma Death Row Records schuldete Tupac und seinen Mitarbeitern zuletzt 13 Millionen Dollar Tantiemen. «Verträge gab es keine.»
LaPolt ist überzeugt: «Tupac wäre eine der grössten Persönlichkeiten unserer Zeit.» Heute durchdringt Hip-Hop jeden Lebensbereich, jeder Börsianer trägt Kapuze, jeder Popsong gebärdet sich ein bisschen als Rap, und im US-Kongress flicht die demokratische Abgeordnete Cynthia McKinney gern ein «Wie schon Tupac sagte...» in ihre Reden ein. Sie hat die Offenlegung aller polizeilichen Akten verlangt, auf dass der Mord geklärt werde.
Politik, Mode, Werbung, Film – Hip-Hop ist überall, und Tupac war sein erster Superstar. «Wirtschaftlich betrachtet, starb er fünf Jahre zu früh», sagt Dina LaPolt. «2001 erst wurde Rap Mainstream, seither dominiert er alle Hitlisten.» Freilich ist auch Tupac heute überall. Sein Leben wird im Stück «Up Against The Wind» an Theatern aufgeführt, am Broadway ist ein Musical geplant, an der University of Florida lehrt Harun Karim Thomas seine Texte an der literarischen Fakultät.
LaPolt, bekennende Lesbe, stört sich nicht an Tupacs Frauenbild. «Er machte Hunderte Songs. Drei, vier davon enthalten Abschätziges über Frauen», sagt sie. «Tupac rappte halt, was er sah. Wenn er von Huren und Schlampen sprach, dann deshalb, weil es da draussen Huren und Schlampen gibt. Kunst ist Kunst. Hat man Picasso vorgeworfen, er wolle alle Frauen köpfen, nur weil er Frauen ohne Kopf gemalt hat?»
Natürlich hat der frühe Tod den Mythos genährt. Über keinen wird so viel Wäsche im World Wide Web gewaschen wie über ihn. Mal wird Tupac zum Messias verklärt, mal verteufelt. Wer war er? Tupac schrieb als 17-Jähriger Gedichte, die einem 50-jährigen Poeten gut anstünden. Er war ein talentierter Schauspieler, brillierte im Film «Juice» als jugendlicher Totschläger, in «Gang Related» als verbrecherischer Cop und in «Gridlock’d» als Suchtkranker. Er war kein tumber Rapper Hotzenplotz, eher ein Revoluzzer. Sein Kodex eines «thug life», eines Gaunerlebens, war nicht Verherrlichung des alltäglichen Bandenkriegs, sondern der Versuch, im Überlebenskampf der afroamerikanischen Unterschicht minimale Anstandsregeln durchzusetzen. Naiv vielleicht, aber rührend engagiert: «Deale nicht auf Schulhöfen!», «Vergewaltige nicht!», «Gib keine Drogen an Schwangere ab, das ist Babymord!», «Schone ältere Leute!»
Und weil er die Jugend für die Techniken der Macht sensibilisieren wollte, nannte er sich Makaveli, in Anlehnung an den italienischen Denker Niccolò Machiavelli. Tupac porträtierte eine Generation, die nichts zu verlieren hatte. Schon sein allererster veröffentlichter Rap, «Brenda’s Got A Baby», erzählte die wahre Geschichte einer zwölfjährigen Mutter, die ihr Neugeborenes aus Verzweiflung in den Müll geworfen hatte. «Words of Wisdom» auf seinem Debüt «2Pacalypse Now», 1991, war eine rassen- und klassenkämpferische Anklage, wie Amerika sie nie gehört hatte. Daneben bleibt Kurt Cobain, im selben Jahr kometenhaft aufgestiegen, ein unbedeutendes Häufchen Elend. Ein Reporter der Gettos, ein Mahner wider gesellschaftliches Unrecht, auch das war Tupac, und es macht ihn zum vermutlich einflussreichsten Toten der Popkultur seit Bob Marley.
Man muss nur seinen Freund Ghobad Mohammad Rahimi fragen, Künstlername Gobi. Der 41-jährige Fotograf und Regisseur, der Shakurs letzte Videos drehte, hat eben den Porträtband «Thru My Eyes» publiziert. «Weil ich Tupacs öffentliches Bild korrigieren will.» Gobi, ein ranker Kerl mit drapierter Haartolle und leise ergrautem Frank-Zappa-Bärtchen, sitzt an seinem Schreibtischlein in der Fotogalerie Farmani am Robertson Boulevard in Los Angeles. «Ich kannte ihn die letzten acht Monate seines Lebens», sagt Gobi. «Tupac war kein Unruhestifter mehr. Er steckte in einem Wandlungsprozess, sagte immer: ‹In einem halben Jahr wird kein Mensch mich wiedererkennen.›»
Im Bett mit Madonna
Gobi dreht sich nach einem Tupac-Bild an der Wand um, sein braunäugiger Blick ähnelt jenem des ermordeten Freundes. «Er wollte in die Politik, sprach schon davon, Bürgermeister von L.A. zu werden. Tupac sagte: ‹Alle Politiker sind Betrüger und Lügner.›» Der Satz war ihm lieb: «All politicians are crooks.» Ein Wortspiel: Er selber hiess bürgerlich Lesane Parish Crooks. «Nicht ich bin der wahre Gangster», wollte er sagen, «sondern die.» Nur einer von vielen Sprüchen, die sich der erfolgreichste Gangsta-Rapper der Gegenwart, 50 Cent, bei ihm geborgt hat.
«Lebte er noch, gäbe es viele der Rapper nicht, die heute ein Heidengeld verdienen. All die DMXs, 50 Cents, The Games, blosser Abklatsch», sagt Gobi. «Tupac hat grosse Fussstapfen hinterlassen, nicht einmal Eminem vermag sie auszufüllen – Tupac wäre Eminem geworden.» Will heissen: der erste über alle Stil- und Rassengrenzen hinaus bekannte Weltstar des Rap. Er war auf dem besten Weg dazu. 13 Millionen CDs verkaufte er vor seinem Tod – rund 60 Millionen seither. Weltrekord.
«Er war extrem freundlich, lustig und lebensfroh», sagt Gobi. Und: Tupac war ein Frauenheld. «Videodrehs mit ihm waren crazy. Er wollte mit allen schlafen und alle mit ihm. Sie standen Schlange vor seinem Wohnwagen, meist reichte es nur zu einem hastigen Blowjob. Mit Madonna aber hatte er eine richtige Affäre.»
Tupac und Gobi planten einen Film über Nat Turner, der 1831 einen Sklavenaufstand anführte. «Tupac war daran, sich komplett neu zu erfinden. Er merkte täglich mehr, dass er sich mit den falschen Leuten umgeben hatte. Er kündigte ‹Suge› die Zusammenarbeit auf, wollte ein eigenes Plattenlabel und eine eigene Filmgesellschaft.» Knight, der mafiöse Boss des Labels Death Row, hatte Tupac 1995 aus dem Gefängnis geholt, indem er 1,4 Millionen Dollar Kaution bezahlte. Dafür schuldete ihm Tupac ein einfaches und ein Doppelalbum. «Er unterschrieb nur bei Death Row, weil er unbedingt aus dem Knast wollte», weiss Gobi. Dass Tupac sich nun emanzipierte, ihn sogar auf fehlende Tantiemenzahlungen verklagen wollte, missfiel dem pompösen Zigarrenraucher Knight. Das könnte die Ermordung des Rappers erhellen.
Zunächst hiess es nämlich, Tupac sei das Opfer eines Zwists zwischen Ost- und Westküste geworden. Absurd, wenn man bedenkt, dass er den grössten Teil seines Lebens in New York und Baltimore verbracht hatte, an der Ostküste. Heute wird in US-Medien laut darüber nachgedacht, ob Plattenboss Knight höchstselbst die Rivalität West- gegen Ostküste geschürt und den Kampf Tupac gegen «Biggie» Smalls stilisiert habe, um zu vertuschen, dass er selbst seinen Star erschiessen liess – und sechs Monate später dessen Kontrahenten.
Es begann am Abend des 7. September mit einer Rangelei in der Lobby des «MGM Grand», Knight und Tupac samt Entourage kamen gerade vom Schwergewichtskampf. Mike Tyson hatte, aufgeputscht vom Tupac-Song «Wrote the Glory», Bruce Seldon in der ersten Runde k.o. geschlagen. Um 20.45 Uhr traf die Gruppe auf ein Mitglied der verfeindeten ostküstentreuen Gang The Crips, Orlando Anderson, und verprügelte es. Überwachungskameras filmten, wie Tupac zulangte. Das ergäbe ein Motiv und einen möglichen Täter. War Anderson zweieinhalb Stunden später tatsächlich der Todesschütze? Man kann ihn nicht mehr fragen, er wurde beseitigt. Beseitigt wurde auch der einzige Zeuge, Jungrapper Yafeu Fula – ihm wurde in die Augen geschossen. Freilich muss auch Knight Tupacs Killer gesehen haben, er sass ja am Steuer neben ihm. Doch Marion «Suge» Knight wurde zu dem Fall, ob man’s glaubt oder nicht, bis zum heutigen Tag nicht einvernommen.
Im Buch «LAbyrinth» zeigt Randall Sullivan auf, wie Knight und die alliierte Mörderbande der Bloods die Polizeikorps von Las Vegas und Los Angeles unterwandert und mit eigenen Leuten bestückt haben. In beiden Mordfällen, Tupac und Smalls, verschwanden Beweisstücke, wurden Spuren verwischt. Smalls’ Hinterbliebene verklagten die Stadt Los Angeles und bekamen im Januar 1,1 Millionen Dollar Schadenersatz zugesprochen – weil erwiesen ist, dass korrupte Cops Beweise getilgt und falsche Fährten gelegt haben.
Freitag, der 13.
«Es passte doch in ‹Suges› Businessplan: Tupac stirbt jung, kann nicht mehr aufmucken, wird zur Legende, hinterlässt 200 unveröffentlichte Songs, sprich: 15 Hitalben für Death Row. Das war keine wilde Gangabrechnung, sondern die sehr präzise Arbeit eines gedungenen Killers», behauptet Gobi. «Schauen Sie, alle Einschusslöcher in der Autotür, hinter der Tupac sass, waren in einem winzigen Umkreis. Das galt gezielt ihm, und ‹Suge› sollte es überleben.»
Mehrere Freundinnen hätten ihn schon verlassen, sagt Gobi, weil sie es nicht mehr hören konnten. «Immer du mit deinem Tupac!» Doch der «crazy iranian», wie Tupac ihn nannte, ist besessen vom Gedanken, der Welt zu zeigen, wer der berüchtigte Gangsta-Rapper wirklich war. «Er hätte der Martin Luther King unserer Generation werden können.»
In einem Film – Arbeitstitel: «Seven Days» – will Gobi Tupacs letzte Tage nacherzählen. «Ich sass im University Medical Center sechs Nächte lang von Mitternacht bis acht Uhr in der Früh Wache. Das Chaos, die mangelnde Kooperation von Spital und Polizei, es war grauenhaft», sagt Gobi. «Die Täter drohten am Telefon, sie kämen ihre Tat vollenden. Doch als ich die Polizei anrief, hiess es nur, sie hätten zu wenig Leute, es müsse irgendwo im Spital einen Wachmann haben, ich solle den suchen gehen. Da scheuchte ich halt die Fernsehstationen auf, die veranstalteten dann Rambazamba vor dem Spital, so dass die Killer sich wohl nicht hineintrauten.»
Zweimal wurde Tupac operiert, ein Lungenflügel wurde ihm entfernt. Er lag im künstlichen Koma. «Damit er sich still hielt. In der fünften Nacht fragte die Krankenschwester: ‹Jetzt sitzen Sie schon so lange hier, wollen Sie ihn nicht sehen?› Ich ging zum ersten Mal hinein, sein Gesicht war voller Wasser, auf das Doppelte angeschwollen, ein Finger fehlte ihm, die Wunden klafften. Ich berührte ihn, er war eiskalt. Ich betete und ging.» Am Nachmittag des nächsten Tages, kurz nach 16 Uhr, starb Tupac. Es war Freitag, der 13. September 1996.
Gobi, was war Tupac für Sie?
Er war wie ein kleiner Bruder, ich wollte ihn retten. Aber zuerst hat er mich gerettet. Ich wuchs im Iran auf, flüchtete 1979 in die USA. Hier schimpften sie mich «Kamelreiter» und «sand nigger», ich fühlte mich fremd in Amerika. Bis ich Tupac traf. Er war die Stimme aller Minderheiten.
Was hat ihn umgebracht?
Sein Maul.
Tupac, ein Volksheiliger des schwarzen Amerika, ein Jesus mit Bandana statt Dornenkrone. Draussen auf den Strassen ist er allgegenwärtig, «Tupac immortal», steht gesprayt und gepinselt an Mauern und Verschlägen. Vor der Bank of America verkauft ein Alter im Satinanzug Poster. Der elfjährige Hollis lässt Snoop Dogg links, Janet Jackson rechts liegen und bettelt: «Mama, Mama, darf ich Tupac?» Und im Frisiersalon «All that» am Crenshaw Boulevard wacht Tupac an der Wand neben «Sex Machine» James Brown und Basketballübermensch Michael Jordan darüber, wie sich vom Knirps bis zur Greisin alle für den Samstagabend zurechtschmücken lassen.
«Natürlich arbeite ich auch samstags», bellt Johnny «J» in sein Mobiltelefon, «kommt vorbei! Wir legen gerade letzte Hand an Tupacs neues Album.» Im ersten Stock eines Betonklotzes in Glendale nördlich von Los Angeles hat er sich sein Tonstudio eingerichtet. Johnny «J», 37, der Tupacs klassische Hits produzierte, ist ein Mann von krachender Gastfreundschaft: «Schaut euch um!» «Nehmt!» «Bedient euch!» Laut und abgehackt redet er, maschinengewehrschnell. Gattin Capucine sitzt mit ihren drei Zentimeter langen Fingernägeln daneben und schweigt deko- rativ.
«Pac und ich, wir sind beide Workaholics.» Sagt’s, als wäre Tupac nur rasch aufs Klo gegangen. Doch die Raps, die «J» am Computer mit Beats auf Trab bringt, mit Bässen aufpumpt, mit Geigen garniert und mit Chorstimmen ausschmückt, sind zehn, zwölf Jahre alt. Gegen 200 unveröffentlichte Sprechgesänge hinterliess der Rapper. Zum zehnten Todestag erscheint, zählt man nur die offiziellen, bereits das elfte postume Album. «Tupac war ständig dran», sagt «J». «Er kam immer hier rein – ‹Johnny what’ya got today?› Ich spielte ihm einen Beat vor, er hatte einen Schreibblock vor sich, und los ging’s.»
Johnny «J» gibt den Bescheidenen und triumphiert doch leise: «Alle dachten immer, Dr. Dre hätte diese Hits produziert, aber nein, es war der kleine dreckige Mexikaner.» Johnny, in Mexiko geboren, wurde als Säugling für 40 Dollar nach Los Angeles verkauft, eine illegale Adoption. «Tupac sagte mir immer: Lass dich von dieser Kacke nicht kaputtmachen. Ich bin sicher, Pac hätte seine eigene Version der Black Panthers auf die Beine gestellt, eine Bewegung der Immigranten und Minderheiten geschaffen.» Der stiernackige Latino trägt ein schwarzes Baseballcap überm Millimeterschnitt, die nahe beieinander liegenden Augen sind müde, das Gemüt ist wach. Auf seinem Shirt: Tupac. «Wohin ich gehe, dahin geht auch er», sagt «J». Über dem Mischpult eine Wanduhr, deren Zifferblatt Tupac ziert: «Ich schaue zu ihm auf.»
Die Studioräume, dunkelgrau ausgekleidet und grellrot möbliert, sind eine einzige Gedenkstätte. Überall Duftkerzen, Champagner- und Cognacflaschen. Louis Roederer Cristal und Hennessy, Tupacs Favoriten. «Er sass einfach da, ass frittiertes Huhn – Tupac ass immer frittiertes Huhn –, soff Hennessy aus der Flasche, als wär’s Wasser, kiffte pausenlos, sagte, ‹vielleicht sind wir ein wenig zu betrunken, aber einen machen wir noch›», erzählt «J».
Der verlorene Sohn
Er klickt auf seine Maus, fingert an den Reglern, schon ertönt ein unveröffentlichtes Stück, das garantiert der Heuler dieses Herbstes wird – Refrain: «Don’t fuck with me!» Tupac klingt 2006 so frisch, weil er 1996 seiner Zeit weit voraus war. Die seidenweiche Diktion knallharter Reime, das erotische Nuscheln, das Einsprenkeln süffiger Soulrefrains und die intelligente Provokation – all das haben sich die Nachahmer von ihm abgehört. «Wir bringen nicht jeden Scheiss aus dem Nachlass raus», sagt «J», grinst, fügt an: «Aber es gibt gar keinen Scheiss», und freut sich über den gelungenen Gag.
Was hat ihn umgebracht?
Neid.
Was war er für Sie?
Alles. Verstehst du? So einen finde ich nie wieder. Ich bin seine andere Hälfte, er hat die Texte gemacht, ich die Musik. Ich stand daneben, als er zwei Jahre vor seinem Tod in New York angeschossen wurde, und ich dachte: Den bringt nichts um. Als ich dann am 13. September 1996 in Las Vegas eintraf, sass seine Mutter da, rauchte und sagte: «Er schafft es.» Wir waren hungrig, wollten Burger holen. Kaum waren wir losgefahren, hiess es: Er ist tot. Meine Welt brach zusammen.
Die Inner City von Baltimore, unmittelbar hinter den Einkaufszentren und glitzernden Bürotürmen von Downtown gelegen, ist eine der deprimierendsten Wohngegenden der USA. Was heisst Wohnen? Hier vegetieren die Menschen, ausschliesslich Afroamerikaner. Fensterlose Grocery- und Liquor-Stores, vernagelte Abbruchhäuser, Autowracks. An der Greenmount Avenue deutet ein zahnloser Alter mit Namen Kenneth Young auf das Haus Nummer 3955. «Tupac war ein guter Junge, dort auf der Treppe sass er und schrieb seine Raps.» Warum seine Mutter 1986 von New York hierhin zog? «Weil es hier Crack in Fülle gab. Diese Strasse allein zählt 89 Cracktote», sagt Young. Es ist eine kurze Strasse. Baufällige hundertjährige Backsteinhäuser, immer drei in einer Reihe, mit Erkern und Veranden. Tony Harrison wohnt nun in dem Haus, wo Tupac seine Jugendjahre verbrachte, er späht aus geröteten Äuglein, jung vergreist, vom Crack entstellt, und lallt. Im Gestrüpp liegen leere Bier- und Schnapsflaschen.
Donald Hicken, rötlicher Teint, weisser Bart, leitet seit 26 Jahren die Schauspielabteilung der Baltimore School for the Arts, er hat sein Büro seit Amtsantritt nie aufgeräumt – Masken voller Staub, vergilbte Fotos, alte Theaterplakate und Bücher, Bücher, Bücher. «Die Stadt ist völlig rassengetrennt, Schwarze und Weisse gehen nie gemeinsam zur Schule. Weil unsere Kunstakademie unentgeltlich ist, treffen sie sich dann hier als Teenager, und die Vorurteile und das Misstrauen verpuffen», sagt Hicken. «Tupacs bester Freund war ein reicher Weisser.» Shakur bezeichnete die Jahre an der Kunstschule als beste Zeit seines Lebens. «Später kam er oft zurück, erzählte den Schülern, wie er hier sich selbst entdeckt hatte, und ermunterte sie, ihren Weg zu gehen. Einmal platzte die Präsidentin unserer Gönnervereinigung in eine von Tupacs Reden, jedes zweite Wort war ‹motherfucker›, und ich glaube, sie war ein bisschen schockiert.»
Die Schule ist in einem heruntergekommenen einstigen Prunkhotel in Baltimores Opern- und Museumsviertel untergebracht. «Ich erinnere mich an die funkelnde Energie, als er zum ersten Mal vorsprach. Er hatte immer dieses schelmische Lächeln, und die Ladys himmelten ihn an, alle.» Hicken redet über Tupac wie über einen verlorenen Sohn. Er hat ihn sehr gemocht. «Wenn sie am Morgen im Kreis sassen und einander die Reime vortrugen, die sie in der Nacht zuvor geschrieben hatten, war er immer im Zentrum. Sein Sprach- und Rhythmusgefühl waren fantastisch, ob er rappte oder Shakespeare rezitierte.» Einzig am allerersten Tag sei Tupac ausgelacht worden, als er in der Vorstellungsrunde seinen Namen nannte. «Da wurde er sehr ernst, erklärte, dass Tupac Amaru der Name eines Inkaführers sei und dass er kein Gelächter dulde.»
Und Schwarzenegger privat?
Zunächst machte Tupac seine Hausaufgaben nicht. «Wir mussten ihn ins Provisorium versetzen. Aber als seine Mutter dann nach Oakland zog, war er stinksauer. Er hätte unbedingt seinen Abschluss hier machen wollen», sagt Hicken. «Schade. Er war ein umwerfender Schauspieler. Er hätte einen guten Hamlet gegeben.»
Der Schauspiellehrer erinnert sich an Tupacs letzten Besuch. «Er kam mit einer Gang hier an, umgeben von vier finsteren Leibwächtern mit gezückten Waffen. ‹Es ist nicht nötig, dass du die Figur, die du darstellst, auch in deinem Privatleben bist›, sagte ich. ‹Keiner verlangt von Schwarzenegger, dass er Leute vermöbelt. Es ist unfair, dass deine Industrie das von dir verlangt.› – ‹Ich muss, sonst kaufen die Leute meine CDs nicht.› – ‹Du bist ein Künstler, gib dieses Gehabe auf!› – ‹Sie verstehen nicht, dass ich ein Revolutionär bin.› – ‹Du beschreibst eine kaputte Welt, aber um sie zu verbessern, musst du politisch handeln, nicht kriminell, das bringt dich in Gefahr.› Seine Typen verliessen den Raum, ich hielt ihn am Ärmel zurück: ‹Pass auf, für die bist du tot mehr wert als lebendig. Es wird dich das Leben kosten.› Danach sah ich ihn nie wieder.»
Was hat ihn umgebracht?
Er schuf sich zu viele Feinde.
Was war er für Sie?
Er ist ein schrecklicher Verlust. Der Junge war so voller Energie, so kreativ, seine Möglichkeiten waren unbeschränkt. Hätte ihn die Rapindustrie nicht kaltgemacht, jemand anderes hätte es getan. Er hatte revolutionäres Bewusstsein. Er wäre zu gefährlich geworden.
Tupacs Verhängnis war seine Rolle. Er schoss und wurde angeschossen, wegen sexueller Belästigung angeklagt, wegen unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt, inhaftiert, er verstiess gegen Bewährungsauflagen. Er war in seinem Image gefangen. Seine besten Texte erschienen erst vier Jahre nach seinem Tod. Er war beides, war Täter-Opfer und darin typisch für die Umgebung, in der er aufwuchs. «Thug life» war ein Spiel für Tupac, aber er war ein so guter Schauspieler, dass er sich zu Tode spielte.
Als die Schüsse auf der East Flamingo Road ihn trafen, sass Tupacs Lieblingscousine Jamala Lesane im Hotel. «‹Ich will, dass ihr in Sicherheit seid, bleibt im Hotel›, hatte Pac zu mir und seiner Freundin Kidada gesagt. ‹Und dafür hast du uns nach Vegas geschleppt?›, motzten wir. Nach dem Boxkampf kam er kurz zurück, zog ein weissschwarzes Basketballshirt über, erzählte noch, es habe eine Rangelei gegeben.» Minuten später der Anruf. «Wir rasten im Taxi ins Spital. Als ich ihn sah, fiel ich auf die Knie. Er war übel zugerichtet.»
Jamala Lesane sitzt im Schneidersitz am Boden ihres winzigen Büros. Die 37-Jährige leitet das Tupac Amaru Shakur Center for the Arts in Stone Mountain ausserhalb Atlantas. Ein öder Freeway führt hierhin, gesäumt von Kirchen, Tankstellen und dem Kanon der amerikanischen Schnellverpflegung – IHOP, KFC, McDonald’s, Arby’s, Shoney’s, Taco Bell. «Wir führen aus, was er wollte: einen sicheren Hafen schaffen für Randständige, die an Kunst interessiert sind», sagt Jamala. Im verspiegelten Tanzstudio nebenan üben Kinder ein Hip-Hop-Ballett. Das Zentrum fördert Talente, führt Gedichtabende und Sommerlager durch. Noch ist es nicht der internationale Hort für Konfliktlösung, von dem Jamala träumt. Eher ein typisch amerikanisches Nachbarschaftsprojekt, konkrete Sozialarbeit in einem sozial schwachen Staat.
«Wenn er als Kind Scherereien hatte, sagte er immer: ‹Ich hol meine Cousine, die verprügelt dich dann!› Für Pac war ich wie eine grosse Schwester.» Tupac und Jamala wuchsen in Harlem unter einem Dach auf, zuletzt lebte sie in Tupacs Haus im kalifornischen Calabasas. «Mein Job war, ihm Chicken zu frittieren. Er wurde immer häuslicher, wollte mit Kidada, Quincy Jones’ Tochter, eine Familie gründen. Früher hatte er jede Nacht eine Horde bitches im Haus, und ich musste diese Groupies dann filzen, bevor sie heimgingen: ‹Schau, dass sie nichts klauen›, befahl er.» Jamala – rote Punkfrisur, herzförmige Ohrhänger – lacht rauchig. «Er war nicht einfach ein Sexprotz. Schon als 17-Jähriger forderte er Aufklärung über Drogen, Sex und Polizeigewalt an den Schulen. Man solle den Kindern erklären, warum es Rassismus, Armut und Hunger gebe in Amerika.» Beim Erzählen schnippt sie rhythmisch mit den Fingern, rappt fast.
Dann schlendert Jamala durch den Park hinter dem Kulturzentrum. Ahornschatten mildert die Südstaatenhitze, eine bronzene Statue zeigt Tupac bebrillt als alten Mann. «Er ahnte seinen Tod und scherzte doch dauernd darüber. Noch am Mittag, bevor es geschah, sagte er: ‹Kremiert mich und raucht meine Asche!›» Jamala lacht ihr gurgelndes Lachen. «Und raten Sie mal, was wir getan haben.»
Wer Hass sät
Schnurgerade führt die Interstate 95 durch Fichten- und Kiefernwälder ins versunkene Lumberton, North Carolina. Ein Lieferwagen, der aussieht wie eine überdimensionale Musikdose, bimmelt durchs Städtchen und lockt die Kinder mit Eiscreme. «Hier kam ich zur Welt», sagt Afeni Shakur, 59, «wie schon meine Mutter, meine Grossmutter, Ur-, Urur- und Urururgrossmuter. In meiner Kindheit war Lumberton streng rassengetrennt, meine Mum putzte bei den Reichen und pflückte Baumwolle. Sie verliess meinen Vater, weil er sie schlug.» Afeni ging nach New York, schloss sich den Black Panthers an, wurde nach einem Bombenattentat, das sie nicht verübt hatte, eingesperrt, verteidigte sich 1971 selbst gegen 156 Anklagepunkte, ohne Anwalt. Shakur, die damals noch Alice Faye Williams hiess, wurde freigesprochen. Ein kleines Wunder. Einen Monat und drei Tage später gebar sie Tupac.
Es folgten Cracksucht, gescheiterte Beziehungen – einer ihrer Exmänner, Mutulu Shakur, sitzt seit 1986 im Knast –, ein Irrweg durch die USA, Baltimore, Oakland, Atlanta. Und jetzt hat sie sich am Geburtsort zur Unruhe gesetzt: als geschäftige Nachlassverwalterin ihres Sohnes. «Ich bin froh, dass das Glück mich so spät gefunden hat, früher hätt ich’s womöglich vermasselt.» Shakur lebt mit ihrem neuen Ehemann Gust Davis, einem Prediger, auf einem 23 Hektar grossen Anwesen. Hier baut sie mit einer Hand voll Gehilfen Okra, Bohnen, Kartoffeln, Gurken, Tomaten und Mais an, auch Kühe hält sie. «Wir sind der einzige Biobetrieb im ganzen Bezirk!» Die alte Weltverbesserin auf ihrer jüngsten Mission: Biobäuerin. «Ganz Amerika ernährt sich ungesund, ich will das ändern», sagt Shakur und lässt Kartoffelsalat, Gemüsedips, Wurst und frittierte Crevetten auftragen.
Dünn und klein ist sie, trägt ein schwarzes Top, Jeans, gelbe Turnschuhe. Sie hat das Gesicht einer jungen und die Gestik einer alten Frau. «Mein Sohn wusste, dass sein Leben kurz sein würde. Deshalb arbeitete er wie ein Getriebener. Wenn er ein Album veröffentlichte, hatte er immer schon drei weitere parat.» Shakur zündet eine Newport Menthol an, ihre Stimme zittert ins Weinerliche, sie fasst sich ans Herz und haut dann mit der Faust auf den massiven Tisch aus Pekannussholz. «Er war ein Aktivist! Tupac karikierte die Vorurteile des weissen Amerika, doch alle sahen ihn als lumpigen Gangster. Sein Motto ‹thug life› war ein Akronym, es stand für: The Hate You Gave Little Infants Fucks Everybody – die Gesellschaft erntet an Gewalt, was sie an Hass gesät hat. Er wusste, dass er die Weissen nicht davon abhalten konnte, uns Schwarze ‹thugs› zu nennen, er konnte es nur positiv besetzen. Er tat es mit seiner sprachlichen Meisterschaft.»
Afeni Shakur glüht und erblüht, lacht gurgelnd, spricht mit den Händen, predigt, platzt fast. «Tupac wollte eine Nation junger Menschen erziehen, wollte ihnen – deshalb nannte er sich Makaveli – klar machen, welches die Regeln der Staatsräson sind und wie sie gegen uns verwendet werden. Nicht viele haben ihn begriffen. Er bildete sich nicht ein, er könne Amerika verändern. Er wollte nur Überlebenshilfe für die Welt leisten, der er angehörte, denn er sah, dass junge Afroamerikaner keine Wahl hatten. Sie landeten im Gefängnis, in den Drogen – oder sie starben jung.»
Überall Kinderfotos von Tupac, über dem Cheminée hängen afrikanische Masken. Afeni Shakur steht auf, kramt in ihrem Büro nach etwas, kommt mit einer Kugelschreiberzeichnung zurück, die ihren Sohn zeigt. Dazu ein handgeschriebener Brief – von Eminem. «Ist das nicht rührend? Marshall» – sie nennt den grössten Rapper der Gegenwart bei seinem bürgerlichen Namen – «Marshall hat mir das zu Weihnachten geschickt, es war etwa 98 Mal umwickelt und linkisch verpackt.» Eminem entschuldigt sich für die Unbeholfenheit seiner Zeichnung. «Ich hatte nicht die richtigen Stifte.» Und dann: «Liebe Afeni, du hast keine Ahnung, wie sehr dein Sohn die Welt beeinflusst hat. Für mich war er die grosse Inspiration. Tupac gab mir den Mut, hinzustehen und zu sagen: ‹Das bin ich, und wenn’s euch nicht passt, go fuck yourself!›» Herzig, wie der angeblich schamlose Eminem statt «fuck» nur «f***» schreibt. Afeni zeigt den Brief gurrend vor Stolz, sie strahlt.
Gleich darauf zürnt sie wieder. «Viele, die Pac auf dem Shirt tragen, sein Bild anbeten, verstehen ihn als Gewalttäter. Wir wollen diese falsche Verehrung bekämpfen. Lebte er noch, seine Zentren wären im ganzen Land verteilt. ‹Thug mansions› hätte er sie genannt und darin jungen Menschen die Möglichkeit zur künstlerischen Selbstverwirklichung gegeben und ihnen Gewaltfreiheit beigebracht.» Ob man das glauben darf? Durch seine Platten peitschten Salven, die Parolen waren teils mörderisch. Noch zu Lebzeiten geisselte er aber selbst die Gangster-Pose als «ignorant und dumm» und versprach dem Magazin Vibe: «Ich werde mich ändern.» Afeni Shakur insistiert: «Glauben Sie mir, es war sein Plan, und mit unserem Tupac-Amaru-Zentrum führen wir ihn aus. Tupac hat einen Rieseneinfluss auf verstossene, ungewollte, missbrauchte, unglückliche junge Aussenseiter auf der ganzen Welt. Er tut unglaublich Gutes für Menschen, die null Hoffnung haben.»
Shane fällt mir ein, der junge Ire, den ich in Los Angeles getroffen habe, über und über tätowiert mit den Tattoos, die auch Tupac trug. «Ich wollte mir mit 15 das Leben nehmen, Tupac hat es mir gerettet», sagt er im lakonischen Tonfall der Iren. Shane zog nach L.A., schlug sich als Metzger und Türsteher durch, gab sich den Namen Cabo, begann zu rappen. «Jetzt will ich mit meiner Musik anderen helfen, wie Tupac mir half.» Cabo reist oft nach Irland und ermahnt die Schulkinder rappend, sich nicht umzubringen.
Frau Shakur, das Internet quillt über vor Legenden, Tupac lebe noch. Lebt er?
Sehen Sie, ich Grossmütterchen bin CEO von Amaru Records, dabei habe ich von Hip-Hop keinen Schimmer. Ich leite die Stiftung, ich bin die Chefin von allem. Wäre er am Leben, würde ich bloss stricken.
Liess «Suge» Knight ihn ermorden?
Er, Puff Daddy von Bad Boy Records oder sonst jemand – wie wollte ich es wissen? Und wieso soll ich auch nur eine Sekunde verwenden, es herauszufinden, wenn es ihn nicht zurückbringt? Ich kann nur sein Erbe in Umlauf bringen und dafür sorgen, dass die Leute ihn nach seinem Werk beurteilen.
Gibt es etwas, das Sie als Mutter bereuen?
Dass ich einst jede Hoffnung fahren liess und mich der Drogensucht ergab. Anderseits wäre ich ohne jene Erfahrung nicht imstande gewesen, zu vollbringen, was ich heute tue. Es hat mich Demut gelehrt. So gesehen, bereue ich nichts.
Zwei Tage nach Tupacs Tod predigte der schwarze Aktivist Jesse Jackson in einer Baptistenkirche in Las Vegas: «Verurteilt Tupac nicht, weil er Frauen Schlampen nannte. Er wurde von einer Cracksüchtigen aufgezogen, der Bub hatte nie eine richtige Mutter.» Wie stecken Sie solche Verletzungen weg?
Wissen Sie, was wir getan haben – meine Schwester und ich? Wir liessen Herrn Jackson zu uns kommen, und er musste sich entschuldigen. Aber ich bin niemandem böse. Niemandem.
Was brachte Tupac um?
Das Leben. Das Leben hat Tupac getötet.
Was war er für Sie?
Mein Sohn. Er war mein Sohn. Ich hatte zuvor Fehlgeburt nach Fehlgeburt gehabt. Ihn trug ich im Bauch, als ich im Gefängnis war. Alles sprach gegen diese Geburt, aber er wollte kommen. Er blieb in meinem Bauch, als ich vor Gericht um mein Leben kämpfte. Mein Erstgeborener. Er war so fröhlich, so voller Leben, so kreativ, ein gutes, friedfertiges Kind. Sein Herz war so rein.
[Von Bänz Friedli für Weltwoche.ch]
|