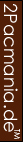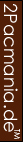|
|
 Tupac Amaru Shakur - Presse über ihn
Tupac Amaru Shakur - Presse über ihn
|
Der heilige Hurensohn
Am 13. September 1996 starb der Rapper Tupac Shakur im Kugelhagel. Seitdem wird er verehrt wie Jimi Hendrix oder Bob Marley. Hat er das verdient?
Vierspurig drückt der Abendverkehr ostwärts über die East Flamingo Road in Las Vegas. An der Kreuzung zur Koval Lane liegen Scherben und flach gewalzte Miller-lite-Büchsen auf dem Asphalt, leere Chipstüten tanzen, gejagt vom trockenen Wüstenwind, über die Betonplatten des Gehsteigs.
Keine Gedenktafel, nichts erinnert hier an den 7. September 1996. Ein weißer Cadillac stoppte damals am Rotlicht neben dem schwarzen BMW 750, hinter dessen getönten Scheiben der Rapper Tupac Amaru Shakur und sein Impresario Marion »Suge« Knight saßen. Vom Rücksitz des Cadillacs wurden 13 Schüsse abgefeuert. Drei trafen den hageren Tupac, der korpulente Knight wurde von Hülsen- und Glassplittern gestreift. Sekunden nur, dann tauchte der Cadillac ins Dunkel weg; der Täter wurde nie gefasst. Tupac erlag sechs Tage später den Schussverletzungen.
Jetzt ist er eine Wachsfigur. Für Augenblicke wähnt man ihn leibhaftig dort hinten im Halbdunkel, an diesem Morgen im April bei Madame Tussaud’s Las Vegas. »Es ist schmeichelhaft, dass Pac nach zehn Jahren endlich diese Anerkennung bekommt«, sagt seine Schwester, die Modedesignerin Sekyiwa Shakur. Die mächtige Schönheit verrenkt aus Verlegenheit ihre langen Finger, dass es knackt. Dann weint sie ein bisschen, wie alle Umstehenden. Und aus den Lautsprechern rappt Tupac: »Jeder Tag könnte mein letzter sein, das kommt davon, wenn man das Leben schnell lebt.«
Minuten nachdem die Statue enthüllt wurde, gibt es Tupac im Museumsshop auf Shirts und Tassen zu kaufen – neben amerikanischen Ikonen wie Marilyn, Elvis, John Wayne. Hat die Heiligsprechung eines Hurensohns eingesetzt? Wir wissen doch, was dieser Tupac für einer war. Der Spross einer straffälligen Drogensüchtigen rappte mit Vorliebe über Knarren und Fotzen, er schoss und prügelte sich durch ein kurzes Leben – die Story von Aufstieg und Fall des Ghettojungen Tupac ist rasch erzählt. Aber stimmt sie auch?
»Jede seiner Platten enthält Botschaften, die von sozialem Bewusstsein zeugen.« Die Anwältin Dina LaPolt stützt sich auf dem wächsernen Prince ab, den sie um drei Kopflängen überragt. LaPolt hat in jahrelanger juristischer Kleinarbeit für die Familie die Rechte an Tupacs Werk zurückerstritten, darunter 153 unveröffentlichte Songs, die »Suge« Knight für sich beanspruchte. LaPolt ist überzeugt: »Tupac wäre eine der größten Persönlichkeiten unserer Zeit.«
Heute durchdringt Hip-Hop viele Lebensbereiche, ist zur global dominierenden Popkultur geworden. Börsenmakler tragen Kapuze und im US-Kongress flicht die demokratische Abgeordnete Cynthia McKinney gern ein »Wie schon Tupac sagte…« in ihre Reden ein. Trotzdem herrscht wenig Sinn für die Feinheiten einer Ausdrucksform, in der Gewaltdarstellungen im Kontext eines brutalen Ghetto-Alltags gesehen werden müssen. Tupacs Aufstieg zum ersten Superstar des Hip-Hop vollzog sich zur Hochzeit des Gangstarap, und seine Konflikte mit dem Gesetz, sein Knastaufenthalt und Tod scheinen den Eindruck zu bestätigen, dass Leben und Kunst hier deckungsgleich waren. Dabei stellt schon Tupacs auf Platten verbreiteter Kodex eines »Thug Life«, eines Gaunerlebens, keine Verherrlichung des Bandenkriegs dar, sondern den Versuch, im Überlebenskampf der Unterschicht Anstandsregeln durchzusetzen.
Shakurs Freund Ghobad Mohammad Rahimi, kurz Gobi, will das öffentliche Bild korrigieren. »In den letzten Monaten seines Lebens war Tupac kein Unruhestifter mehr. Er wollte in die Politik, sprach schon davon, Bürgermeister von L.A. zu werden.« Gobi, ein ranker Kerl mit leise ergrautem Frank-Zappa-Bärtchen, sitzt an seinem Schreibtisch in der Fotogalerie »Farmani« am Robertson Boulevard in Los Angeles. Der 41-jährige Fotograf und Regisseur, der Tupacs letzte Videos drehte, behauptet: »Tupac wäre Eminem geworden.« Der erste über alle Stil- und Rassengrenzen hinweg be-kannte Weltstar des Rap. Er war auf dem besten Weg dazu. 13 Millio-nen CDs verkaufte er vor seinem Tod – rund 60 Millionen seither.
»Tupac merkte, dass er sich mit den falschen Leuten umgeben hatte«, sagt Gobi. »Er kündigte ›Suge‹ die Zusammenarbeit auf, wollte eine eigene Musik- und Filmgesellschaft.« Knight, der mafiöse Boss der Plattenfirma Death Row, hatte Tupac 1995 aus dem Gefängnis geholt, indem er 1,4 Millionen Dollar Kaution bezahlte. Dass Tupac sich nun emanzipierte, ihn gar auf fehlende Tantiemenzahlungen verklagen wollte, missfiel dem pompösen Zigarrenraucher Knight.
Seit Tupacs Ermordung kursieren Gerüchte, dass das Verbrechensmotiv eher in diesen geschäftlichen Konflikten zu suchen sei als in dem Zwist zwischen Ost- und Westküstenrappern, der damals in den Medien hochgespielt wurde. »Es passte doch in ›Suges‹ Businessplan«, behauptet Gobi. »Tupac stirbt jung, kann nicht mehr aufmucken, wird zur Legende, hinterlässt 200 unveröffentlichte Songs, sprich: 15 Hitalben für Death Row. Dabei hätte Tupac der Martin Luther King unserer Generation werden können.« Idealisiert er den toten Freund? Fest steht: Schon Tupacs allererster veröffentlichter Rap, »Brenda’s Got A Baby«, erzählte die wahre Geschichte einer zwölfjährigen Mutter, die ihr Neugeborenes aus Verzweiflung in den Müll geworfen hatte. »Words of Wisdom« auf seinem Solodebüt 2Pacalypse Now von 1991 war eine rassen- und klassenkämpferische Anklage, wie Amerika sie nie gehört hatte.
»Gobi, was war Tupac für Sie?«
»Er war wie ein kleiner Bruder, ich wollte ihn retten. Aber zuerst hat er mich gerettet. Ich wuchs im Iran auf, flüchtete 1979 in die USA. Hier schimpften sie mich ›Kamelreiter‹, ich fühlte mich fremd. Bis ich Tupac traf. Er war die Stimme aller Minderheiten.«
»Was hat ihn umgebracht?«
»Sein Maul.«
Besorgten Eltern blieb Tupac auch tot eine Reizfigur, dem schwarzen Amerika ist er ein Volksheiliger. Draußen auf den Straßen ist er allgegenwärtig. »Tupac immortal«, steht gesprayt und gepinselt an Mauern und Holzverschlägen.
»Natürlich arbeite ich auch samstags«, bellt Johnny »J« in sein Mobiltelefon, »kommt vorbei! Wir legen gerade letzte Hand an Tupacs neues Album.« Im ersten Stock eines Betonklotzes in Glendale nördlich von Los Angeles hat er sich sein Tonstudio eingerichtet. Die Sprechgesänge, die »J« am Computer mit Beats auf Trab bringt, mit Bässen aufpumpt, mit Geigen garniert und mit Chorstimmen ausschmückt, sind zehn, zwölf Jahre alt. Zum zehnten Todestag erscheint bereits das elfte postume Album – produziert von dem Mann, der bereits für viele von Tupacs klassischen Hits verantwortlich war. »Tupac war ununterbrochen dran«, sagt »J«. »Er kam hier rein und sagte: ›Johnny, what’ya got today?‹ Ich spielte ihm einen Beat vor, er hatte einen Schreibblock vor sich – und los gings.«
Tupac klingt 2006 so frisch, weil er 1996 seiner Zeit voraus war. Die seidenweiche Diktion knallharter Reime, das erotische Nuscheln, das Einsprenkeln süffiger Soulrefrains und die intelligente Provokation – all das haben sich Nachahmer wie 50 Cent abgehört.
»Was hat ihn umgebracht, Johnny?«
»Neid.«
»Was war er für Sie?«
»Alles. So einen finde ich nie wieder. Er hat die Texte gemacht, ich die Musik. Als er starb, brach meine Welt zusammen.«
Donald Hicken, rötlicher Teint, weißer Bart, leitet seit 26 Jahren die Schauspielabteilung der Baltimore School for the Arts. Er hat sein Büro seit Amtsantritt nie aufgeräumt – vergilbte Fotos, alte Theaterplakate und Bücher, Bücher, Bücher. Der Schauspiellehrer erinnert sich an den letzten Besuch seines einstigen Schülers. »Tupac kam mit einer Gang hier an, umgeben von bewaffneten Leibwächtern. ›Es ist nicht nötig, dass du die Figur, die du darstellst, auch in deinem Privatleben bist‹, sagte ich. ›Ich muss‹ entgegnete er, ›sonst kaufen die Leute die CDs nicht.‹ Seine Typen verließen den Raum, ich hielt ihn noch am Ärmel zurück: ›Pass auf, für die bist du tot mehr wert als lebendig.‹ Danach sah ich ihn nie wieder.«
»Was hat ihn umgebracht?«
»Er schuf sich zu viele Feinde.«
»Was war er für Sie?«
»Der Junge war so voller Energie, so kreativ, seine Möglichkeiten waren unbeschränkt. Hätte ihn die Rapindustrie nicht kaltgemacht, jemand anderes hätte es getan. Er wäre zu gefährlich geworden.«
Tupacs Verhängnis war seine Rolle. Er schoss und wurde angeschossen, er war in seinem Image gefangen. »Thug Life« war ein Spiel für Tupac, aber er war ein solch guter Schauspieler, dass er sich zu Tode spielte.
Jamala Lesane, Tupacs Lieblingscousine, sitzt im Schneidersitz auf dem Boden ihres winzigen Büros. Rote Punkfrisur, dunkle Stimme. Die 37-Jährige leitet das »Tupac Amaru Shakur Center for the Arts« in Stone Mountain außerhalb von Atlanta. »Wir führen aus, was er wollte: einen Zufluchtsort schaffen für Randständige, die an Kunst interessiert sind«, sagt sie. Im Tanzstudio nebenan üben Kinder ein Hip-Hop-Ballett. Das Zentrum fördert Talente, führt Kurse und Sommerlager durch. »Tupac ahnte seinen Tod und scherzte darüber. Noch am Mittag, bevor es geschah, sagte er: ›Verbrennt mich und raucht meine Asche!‹« Jamala lacht ein gurgelndes Lachen. »Und raten Sie mal, was wir getan haben!«
Schnurgerade führt die Interstate 95 durch Fichten- und Kiefernwälder nach Lumberton, North Carolina. Ein Eiswagen, der aussieht wie eine überdimensionale Musikdose, fährt bimmelnd durchs Städtchen. »Hier kam ich zur Welt«, sagt Afeni Shakur, 59. »Meine Mutter putzte bei den Reichen und pflückte Baumwolle. Sie verließ meinen Vater, weil er sie schlug.« Afeni ging nach New York, schloss sich den Black Panthers an, wurde nach einem Bombenattentat, das sie nicht verübt hatte, inhaftiert, verteidigte sich 1971 ganz allein, ohne Anwalt, gegen 156 Anklagepunkte. Shakur, die damals noch Alice Faye Williams hieß, wurde freigesprochen. Einen Monat und drei Tage später gebar sie Tupac.
Es folgten Cracksucht, gescheiterte Beziehungen, ein Irrweg durch die USA. Jetzt lebt sie wieder am Geburtsort, als Biolandwirtin und Nachlassverwalterin ihres Sohnes. Afeni Shakur zündet eine Newport Menthol an, ihre Stimme zittert, sie fasst sich ans Herz und haut dann mit der Faust auf den massiven Tisch aus Pecannussholz. »Viele, die Pac auf dem Shirt tragen, verstehen ihn als Gewalttäter. Wir wollen diese falsche Verehrung bekämpfen. Lebte er noch, seine Zentren wären im ganzen Land verteilt. Thug Mansions hätte er sie genannt und darin jungen Menschen die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung gegeben und ihnen Gewaltfreiheit beigebracht.«
»Was brachte Tupac um?«
»Das Leben. Das Leben hat Tupac getötet.«
»Was war er für Sie?«
»Mein Sohn. Er war mein Sohn. Ich hatte zuvor Fehlgeburt nach Fehlgeburt gehabt. Ihn trug ich im Bauch, als ich im Gefängnis war. Alles sprach gegen diese Geburt, er wollte einfach kommen. Er war so fröhlich, so voller Leben, so kreativ, ein gutes, friedfertiges Kind. Sein Herz war so rein.«
[Artikel erschienen am 15.09.2006, Süddeutsche Zeitung]
|
|